Das Wichtigste in Kürze
Einführung zur Riester-Rente
Die Riester-Rente stellt eine vom Staat geförderte Variante der privaten Altersvorsorge dar und wurde im Jahr 2002 eingeführt.
Ihr Start war eine Reaktion auf die zunehmenden Herausforderungen des deutschen Rentensystems.
Ziel dieser Förderung war es, die wachsende Lücke zwischen der gesetzlichen Rente und dem tatsächlichen Einkommensbedarf im Alter zu verringern. Durch staatliche Zulagen und steuerliche Vergünstigungen sollte die Bevölkerung dazu motiviert werden, eigenständig Kapital für die Ruhestandsphase aufzubauen.
Vor allem Pflichtversicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung sollten von dieser Unterstützung profitieren. Trotz ihres ursprünglichen Ansatzes, die Altersvorsorge breiter abzusichern, wird die Riester-Rente heute häufig kritisch betrachtet, unter anderem aufgrund komplexer Regelungen, hoher Verwaltungsgebühren mancher Verträge und begrenzter Renditechancen. Dennoch spielt sie weiterhin eine bedeutende Rolle in der Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung der privaten Altersvorsorge in Deutschland.
Im folgenden Beitrag schauen wir uns an, wie die Riester-Rente funktioniert, welche Chancen und Risiken bestehen und für wen sich "Riestern" überhaupt noch lohnen kann.
Wer hat Anspruch auf die Riester-Rente?
Förderberechtigt sind Personen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.
Dazu gehören Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende sowie Beamte und Richter, da auch sie über ein eigenes Versorgungssystem verfügen, das der gesetzlichen Rente gleichgestellt ist. Ebenfalls berechtigt sind Personen, die Elterngeld beziehen oder sich in der Kindererziehungszeit befinden, da sie währenddessen weiterhin als rentenversicherungspflichtig gelten. Auch Arbeitslose, die Arbeitslosengeld I erhalten, können riestern, solange sie Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt werden.
Darüber hinaus besteht eine mittelbare Förderberechtigung: Ehe- oder Lebenspartner von unmittelbar Förderberechtigten dürfen ebenfalls einen Riester-Vertrag abschließen, selbst wenn sie selbst nicht rentenversicherungspflichtig sind. Voraussetzung ist, dass der Partner einen eigenen, förderfähigen Vertrag besitzt und mindestens der Mindestbeitrag eingezahlt wird.
Nicht förderberechtigt sind dagegen beispielsweise Selbstständige und Freiberufler, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen!
Sie können die Riester-Rente zwar grundsätzlich abschließen, erhalten jedoch keine staatlichen Zulagen oder steuerlichen Vorteile. Für diese Personengruppe kommen eher alternative Vorsorgeformen wie die Rürup-Rente oder die private Rentenversicherung in Betracht.
Diese Personen sind förderberechtigt und bekommen die staatliche Förderung
Du erhältst die staatliche Förderung auf dein Riester-Konto, wenn du im Jahr vor deiner Arbeitslosigkeit Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hast. Auch Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II können die Riester-Zulage erhalten. Lege dafür bitte einen Nachweis vor, dass du vor der Arbeitslosigkeit rentenversicherungspflichtig beschäftigt warst.
Du betreust eine pflegebedürftige Person? Dann kannst du Anspruch auf die staatlich geförderte Altersvorsorge (Riester-Zulage und Riester-Steuervorteil) haben.
Voraussetzungen, die du erfüllen musst:
- du pflegst eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 2 oder höher
- deine Pflegeleistung beträgt mindestens 10 Stunden pro Woche
- diese Stunden verteilen sich auf mindestens 2 Tage pro Woche
- die Pflege erfolgt in der häuslichen Umgebung
- die Pflege ist nicht erwerbsmäßig
Außerdem darfst du neben der Pflege höchstens 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Ob du aufgrund der Pflegetätigkeit rentenversicherungspflichtig und somit riester-berechtigt bist, entscheidet dein zuständiger Rentenversicherungsträger.
Wenn Du für die Erziehung Deines Kindes eine Auszeit vom Job nimmst, erhältst Du die Riester-Zulage und kannst den Steuervorteil nutzen.
Während deiner Elternzeit, in der Du keiner rentenversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehst, bist Du jedoch nicht automatisch riester-berechtigt. Damit Du die Zulage bekommst, musst Du zuerst dafür sorgen, dass die Erziehungszeit bzw. Elternzeit bei der Deutschen Rentenversicherung berücksichtigt wird. Den Antrag stellst Du direkt bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Deinem Rentenversicherungsträger. Den „Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten / Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung" (V0800) findest Du hier.
Erhältst du momentan keinen Lohn oder kein Gehalt, sondern Ersatzleistungen für deinen Lebensunterhalt? Dann kannst du staatliche Förderung für deine Riester-Rente bekommen. Das gilt für Riester-Sparer, die Kranken-, Verletzten- oder Versorgungskrankengeld beziehen oder wegen einer Reha Übergangsgeld erhalten. Wichtig: Du musst vor oder während der Zahlung rentenversicherungspflichtig gewesen sein oder weiterhin Rentenbeiträge zahlen.
Hast du einen Minijob und zahlst Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung? Dann erhältst du die staatliche Förderung in Form der Riester-Zulage und Steuervorteile, sofern du eine Riester-Rente besitzt.
Auch als Beamte, Richter oder Soldat kannst du die staatliche Förderung für deine Riester-Rente erhalten. Deine Bezüge- oder Besoldungsstelle kann die dafür notwendigen Daten direkt an die ZfA übermitteln, sofern du dies erlaubst.
Als Landwirt bekommst du die Riester-Zulage und kannst dir den Riester-Steuervorteil sichern. Voraussetzung dafür ist, dass du in der gesetzlichen „Alterssicherung der Landwirte“— der Alterskasse der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau — pflichtversichert bist.
Als Künstler hast du Anspruch auf die staatliche Riester‑Förderung wenn du Mitglied der Künstlersozialkasse bist.
Wenn du eine Rente wegen Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit beziehst, kannst du die Riester-Zulage und den Riester-Steuervorteil erhalten. Voraussetzung ist lediglich, dass du zuvor in der Rentenversicherung pflichtversichert warst. Die staatliche Förderung bekommst du bis zu deinem 67. Geburtstag.
Bist du Bundesfreiwillige*r oder hast du dich für den freiwilligen Wehrdienst gemeldet? Dann bekommst du die Riester‑Zulage und den Steuervorteil, wenn du auf dein Riester‑Konto einzahlst.
Gehörst du keiner der oben genannten Personengruppen an, weil du zum Beispiel selbstständig bist und nicht pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung? Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du die Riester‑Zulage über deinen Ehepartnerin oder eingetragenen Lebenspartnerin erhalten.
Diese Voraussetzungen musst du für den mittelbaren Anspruch auf die Riester‑Zulage erfüllen:
- dein Ehepartner oder Lebenspartner hat einen Riester-Vertrag
- dein Ehepartner oder Lebenspartner ist riester-berechtigt
- ihr seid nicht dauerhaft getrennt
- du zahlst jährlich mindestens 60 Euro in deinen eigenen Riester-Vertrag ein
- dein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im EU/EWR-Gebiet
Beitragsgarantie: Ein Baustein mit Vorteilen und Nachteilen
Ein zentrales Merkmal der Riester-Rente ist die sogenannte Beitragsgarantie. Sie besagt, dass zu Beginn der Auszahlungsphase die gesamten Einzahlung inkl. Zulagen zwingend zur Verfügung stehen müssen.
Mit anderen Worten: Niemand soll durch die Riester-Rente Geld verlieren. Diese Garantie soll Sicherheit bieten und das Vertrauen in die staatlich geförderte Altersvorsorge stärken.
Konkret erklären lässt sich das anhand eines Beispiels: Wer beispielsweise über die Jahre 10.000 Euro an Beiträgen eingezahlt und 2.000 Euro an staatlichen Zulagen erhalten hat, dem müssen zu Rentenbeginn mindestens 12.000 Euro gutgeschrieben sein. Diese Summe darf nicht unterschritten werden und das komplett unabhängig davon, wie sich die Finanzmärkte entwickelt haben.
Allerdings hat diese Sicherheit auch Nachteile. Da die Anbieter die Garantie gewährleisten müssen, sind sie gezwungen, einen großen Teil der Beiträge sehr sicher, also in festverzinsliche Anlagen, zu investieren. Das begrenzt die Chancen auf höhere Renditen, vor allem in Zeiten niedriger Zinsen. Aus diesem Grund wird die Beitragsgarantie häufig auch zu Recht als ein Hauptgrund für die geringe Rentabilität vieler Riester-Verträge genannt.
Darum ist die Beitragsgarantie kritisch zu betrachten
Die Beitragsgarantie der Riester-Rente wird häufig als Sicherheitsmerkmal angeführt, doch gerade für junge Menschen sollte sie kritisch betrachtet werden. Der Grund liegt darin, dass die Garantie zwar Sicherheit verspricht, aber gleichzeitig die Renditechancen stark einschränkt. Anbieter müssen sicherstellen, dass am Ende der Vertragslaufzeit mindestens die eingezahlten Beiträge und staatlichen Zulagen vorhanden sind. Um dieses Versprechen halten zu können, sind sie gezwungen, einen Großteil des Geldes in sehr sichere, aber kaum rentable Anlageformen wie Anleihen oder festverzinsliche Wertpapiere zu investieren.
Für junge Sparerinnen und Sparer, die oft noch mehrere Jahrzehnte bis zur Rente haben, bedeutet das einen erheblichen Nachteil. Sie könnten in dieser langen Zeit eigentlich von den Schwankungen und damit dem Cost-Average-Effekt sowie von den langfristigen Wachstumschancen der Kapitalmärkte profitieren: Also insbesondere von Aktienanlagen, beispielsweise der Beteiligung an Unternehmen wie Apple, Microsoft und Co.
Durch die starre Beitragsgarantie wird diese Chance jedoch weitgehend genommen. Während kurzfristige Verluste durch Marktschwankungen über viele Jahre hinweg problemlos ausgeglichen werden könnten, verhindert die Garantie eine solche langfristige Strategie.
Zudem wirkt sich die Beitragsgarantie in Phasen niedriger Zinsen besonders negativ aus. Die Anbieter müssen die zugesagte Sicherheit weiterhin gewährleisten, können aber kaum noch Erträge erzielen, da sichere Anlagen wie Staatsanleihen in diesen Zeiten nur minimale Renditen abwerfen. Das führt dazu, dass ein großer Teil der Riester-Verträge für junge Menschen real kaum über die Inflationsrate hinauswächst.
Der Umkehrschluss ist: Ihre Kaufkraft im Alter sinkt also trotz jahrzehntelanger Einzahlungen.
Kritiker argumentieren daher, dass die Beitragsgarantie zwar kurzfristig Vertrauen schafft, langfristig jedoch zu ineffizienten und renditeschwachen Produkten führt. Gerade junge Sparerinnen und Sparer, die bereit wären, ein gewisses "Risiko" für eine höhere Rendite einzugehen, werden dadurch benachteiligt.
Trotz dieser Nachteile kann sich eine Riesterrente für bestimmte Personengruppen sehr gut als risikoarme Kapitalanlage lohnen und zwar bei hohen Zulagen in Kombination mit einem geringen Eigenanteil. Zudem kann die Investitionsquote in Aktien und andere gewinnbringende Anlageklassen bei einem guten Anbieter und langem Anlagehorizont relativ hoch sein und somit doch eine attraktive Rendite erwirtschaften.
Du verstehst nur Bahnhof oder möchtest kostenlos von unseren zertifizierten Experten zur Altersvorsorge beraten werden? Dann melde dich gerne bei uns.
Welche Form der Altersvorsorge lohnt sich in Deiner persönlichen Situation?
Jetzt kostenlose Beratung sichern!
Vorteile und Nachteile der Riester-Rente
Vorteile
Nachteile
Wie diese Vorteile und Nachteile im Detail zu verstehen sind, erklären wir im Folgenden.
So berechnet sich der Anspruch auf Zulagen
Um nachvollziehen zu können, für wen sich die Riester-Rente heutzutage noch richtig lohnen kann, ist ein Blick auf die Zulagen notwendig: Welche Zulagen stehen welchen Personen überhaupt zu?
Unterteilen lassen sich die Zulagen bei Riester in die "Grundzulage" und die "Kinderzulage":
- Als Grundzulage gibt es pro Jahr 175 Euro.
- Als Kinderzulage werden 300 Euro pro Jahr gezahlt – und zwar jedes Kind, das ab dem Jahr 2008 geboren worden ist. Ist das Kind vor dem Jahr 2008 geboren, fließen für diese Kinder Zulagen in Höhe von 185 Euro in den Riester-Vertrag.
Es gibt jedoch auch Voraussetzungen, um die Zulagen vollständig zu erhalten:
- Es muss mindestens 4 % des Bruttoeinkommens ("des rentenversicherungspflichtiges Einkommens"), jedoch maximal 2.100 Euro in den Riester-Vertrag eingezahlt werden, um die vollen Zulagen zu erhalten. Die Zulagen selbst werden dabei bereits mitgezählt.
- Wer zum Beispiel nur 2 % (also die Hälfte der 4 %) des Bruttoeinkommens einzahlt, erhält auch nur 50 % der Zulagen. Die Höhe der genehmigten Zulagen wird ebenfalls prozentual berechnet.
- Wer nur 1 % des Bruttoeinkommens einzahlt, erhält dementsprechend nur 25 % der vollen Zulagen.
Generell muss man bei Riester außerdem mindestens den Sockelbeitrag von 60 Euro pro Jahr, also mindestens 5 Euro pro Monat einzahlen.
Wer weniger einzahlt, hat überhaupt keinen Anspruch auf Zulagen.
Beispiel zur Berechnung von Zulagen:
- Ein Vater von 2 Kindern (beide nach 2008 geboren) würde bei vollen Zulagen pro Jahr 600 Euro Kinderzulage erhalten.
- Als Grundzulage stehen ihm außerdem 175 Euro pro Jahr zu.
- In Summe sind das 775 Euro pro Jahr.
- Bei einem Bruttoeinkommen von 35.000 Euro müssten also mindestens 1.400 Euro (das sind 4 %) eingezahlt werden, um die vollen Zulagen zu erhalten.
- Um Anspruch auf die vollen Zulagen zu haben, wäre also ein Eigenanteil von 625 Euro notwendig.
Beispiel eines Gutverdieners:
- Bei einem Bruttojahreseinkommen von beispielsweise 90.000 Euro erhöht sich der notwendige Eigenanteil entsprechend.
- 4 % des Bruttoeinkommens entsprechen in diesem Fall 3.600 Euro.
- Es gibt jedoch eine Begrenzung auf einen Betrag von maximal 2.100 Euro (Kappung der 4 % Regel), der für volle Zulagen erbracht werden muss.
- Nimmt man dieselben Parameter wie zuvor, müssten von den 2.100 Euro noch 775 Euro abgezogen werden. Somit müssten 1.325 Euro pro Jahr als Eigenanteil eingebracht werden, um die vollen Zulagen zu erhalten. Das Verhältnis von Eigenanteil zu Zulagen verschiebt sich also zu Ungunsten des Gutverdieners. Der Grenzsteuersatz bei diesem Einkommen würde wahrscheinlich bei 42% liegen. In diesem Fall würde der Gutverdiener also noch eine kleine zusätzliche Steuererstattung erhalten.
Steuerersparnis bei Riester
Bei der Riester-Rente gilt, dass ein Betrag von bis zu 2.100 Euro als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden kann. Dies erfolgt über die Anlage AV in der Steuererklärung.
Ob man tatsächlich eine Steuerersparnis durch seinen Riester-Vertrag erhält, kommt jedoch auf die persönlichen Parameter an.
Es gilt: Eine Steuererstattung kann man nur dann erhalten, wenn die erhaltenen Zulagen geringer als die Steuererstattung sind.
Beispiele zur potenziellen Steuerersparnis:
- Bei 500 Euro potenzieller Steuerersparnis und 600 Euro Zulagen -> keine Erstattung.
- Bei 500 Euro potenzieller Steuerersparnis und 175 Euro Zulagen -> Differenz von 325 Euro wird erstattet.
Diese Vorgehensweise nennt sich Günstigerprüfung: Hier wird geprüft, ob die Steuerersparnis oder die Zulagen höher sind (also welche Variante "günstiger" für die steuerpflichtige Person ist).
Spezialfall: Geringverdiener mit vielen Kindern
Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen und mehreren Kindern sind ein Sonderfall bei Riester: Für diese Personengruppe lohnt sich Riester ganz besonders, da sie nur einen äußerst geringen Eigenanteil aufbringen müssen.
Beispielrechnungen für hohe Zulagen:
- Eine Mutter von 4 Kindern (alle nach 2008 geboren) würde bei vollen Zulagen pro Jahr 1.200 Euro Kinderzulage erhalten.
- Als Grundzulage stehen ihr außerdem 175 Euro pro Jahr zu.
- In Summe sind das 1.375 Euro pro Jahr.
- Bei einem Bruttoeinkommen von 25.000 Euro müssten mindestens 1.000 Euro (das sind 4 %) eingezahlt werden, um die vollen Zulagen zu erhalten.
- Um Anspruch auf die vollen Zulagen zu haben, wäre also lediglich der Sockelbeitrag von 60 Euro pro Jahr als Eigenanteil zu zahlen
- Somit würden in diesem Beispiel jährlich 1.375 Euro in den Riester-Vertrag fließen.
Eine Steuererstattung gibt es in diesem Beispiel nicht, da die Zulagen deutlich höher als eine potenzielle Steuererstattung sind.
Trotzdem ist die Riester-Rente in diesem Fall äußerst vorteilhaft: Bei einem Betrag von gerade einmal 60 Euro im Jahr fließen für die Mutter von vier Kindern also insgesamt 1.435 € im Jahr in die Riester-Rente. So etwas gibt es sonst bei keiner Form der Anlage.
Aber auch bei 2 Kindern und einem Einkommen von 25.000 Euro hat man einen sehr geringen Eigenanteil:
- Eine Mutter von 2 Kindern (alle nach 2008 geboren) würde bei vollen Zulagen pro Jahr 600 Euro Kinderzulage erhalten.
- Als Grundzulage stehen ihr außerdem 175 Euro pro Jahr zu.
- In Summe sind das 775 Euro pro Jahr.
- Bei einem Bruttoeinkommen von 25.000 Euro müssten also mindestens 1.000 Euro (das sind 4 %) eingezahlt werden, um die vollen Zulagen zu erhalten.
- Die Differenz zwischen 1.000 Euro und den Zulagen sind lediglich 225 Euro pro Jahr – mit diesem geringen Anteil erhält die Mutter 1.000 Euro jährlich in ihren Riester-Vertrag. Die Förderquote liegt also fast bei 80%.
"Geschenktes Geld" bei geringem Einkommen und vielen Kindern
Ein besonderer Vorteil der Riester-Rente zeigt sich bei Menschen mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern. Für sie kann die staatliche Förderung tatsächlich wie „geschenktes Geld“ wirken. Der Grund dafür liegt in den Zulagen, die der Staat zusätzlich zu den eigenen Einzahlungen in den Vertrag einzahlt. Neben der jährlichen Grundzulage (derzeit 175 Euro pro förderberechtigter Person) gibt es die genannten Kinderzulagen, die die Förderung deutlich erhöhen.
Das Besondere: Wer nur ein geringes Einkommen hat, muss selbst nur einen Mindestbeitrag von 4 Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens, abzüglich der Zulagen, einzahlen, um die volle Förderung zu erhalten. Das bedeutet, dass die tatsächliche Eigenleistung oft sehr niedrig ist, während die staatliche Unterstützung vergleichsweise hoch ausfällt. In bestimmten Fällen übersteigen die Zulagen sogar den eigenen Beitrag und die Ersparnis wächst ohne nennenswerte eigene Kosten.
Aus diesem Grund gilt die Riester-Rente trotz ihrer Schwächen bei Rendite und Flexibilität für Haushalte mit geringem Einkommen und mehreren Kindern als eine der attraktivsten Fördermöglichkeiten. Wer die Voraussetzungen erfüllt und die staatlichen Zulagen konsequent ausschöpft, erhält tatsächlich einen erheblichen Teil seiner Altersvorsorge vom Staat „geschenkt“.
Auszahlungsphase der Riester-Rente
Nach der Ansparphase beginnt bei der Riester-Rente die sogenannte Auszahlungsphase, also der Zeitraum, in dem das angesparte Kapital als Rente ausgezahlt wird. Sie startet in der Regel mit dem Eintritt in den Ruhestand, frühestens ab dem 62. Lebensjahr. Der Hauptzweck dieser Phase ist es, das über viele Jahre angesparte und geförderte Guthaben als lebenslange monatliche Zusatzrente auszuzahlen, die die gesetzliche Rente ergänzt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, einen Teil des Vertragsguthabens als Einmalzahlung auszahlen zu lassen.
- Zu Beginn der Auszahlungsphase können maximal 30 Prozent des angesparten Kapitals auf einmal förderunschädlich entnommen werden. Solltest du dir mehr Kapital entnehmen, handelt es sich um eine förderschädliche Verwendung und Steuern und Zuzahlungen sind zurückzuzahlen.
- Die restlichen 70 Prozent müssen dann in eine lebenslange Rentenzahlung umgewandelt werden.
- Auf Wunsch kann das Kapital aber auch vollständig verrentet werden, um eine höhere monatliche Auszahlung zu erhalten. Wir empfehlen idR jedoch, die möglichen 30 Prozent sofort auszahlen zu lassen, da man das ausgezahlte Kapital selber besser anlegen kann, als es der Rentenfaktor einer Versicherung hergibt.
Versteuerung des Riester-Rente
Die Riester-Rente gehört zur sogenannten „nachgelagerten Besteuerung“. Das bedeutet, dass während der Ansparphase die Einzahlungen und Zulagen steuerlich begünstigt sind, die Rentenzahlungen im Alter jedoch voll versteuert werden müssen. Da das Einkommen im Ruhestand in der Regel niedriger ist als während des Berufslebens, fällt die Steuerbelastung meist moderat aus.
Bei der Versteuerung der monatlich ausgezahlten Riester-Rente wird der persönliche Einkommensteuersatz angesetzt.
Außerdem ist die Riester-Rente kapitalgedeckt und lebenslang. Das bedeutet, sie wird nicht aus laufenden Beiträgen anderer finanziert (wie bei der gesetzlichen Rente), sondern aus dem individuell angesparten Kapital. Sollte der Versicherte früh versterben, hängt es vom Vertrag ab, ob das restliche Guthaben an Hinterbliebene ausgezahlt oder zur Absicherung eines Ehepartners genutzt werden kann.
Ansparphase
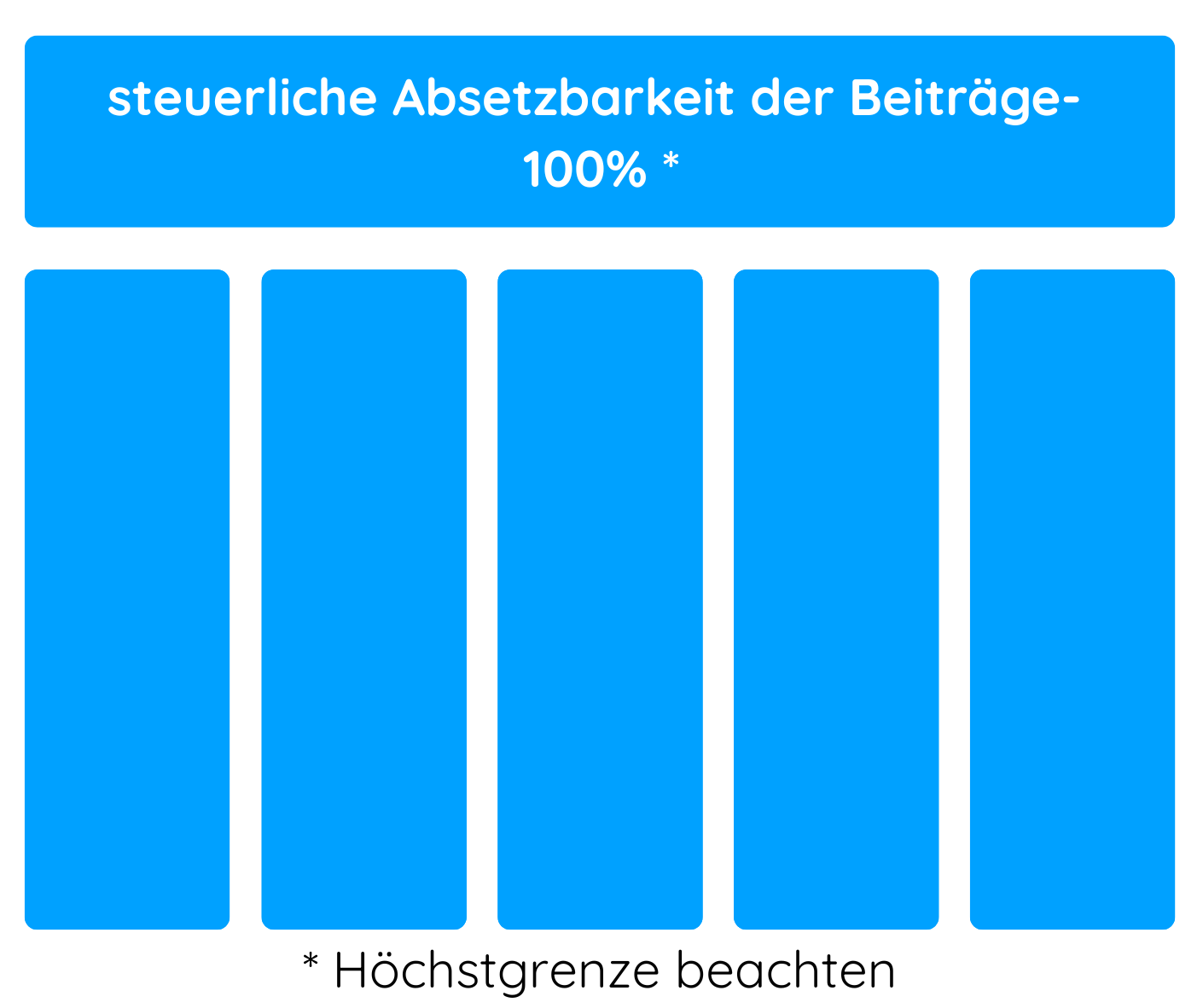
Auszahlungsphase
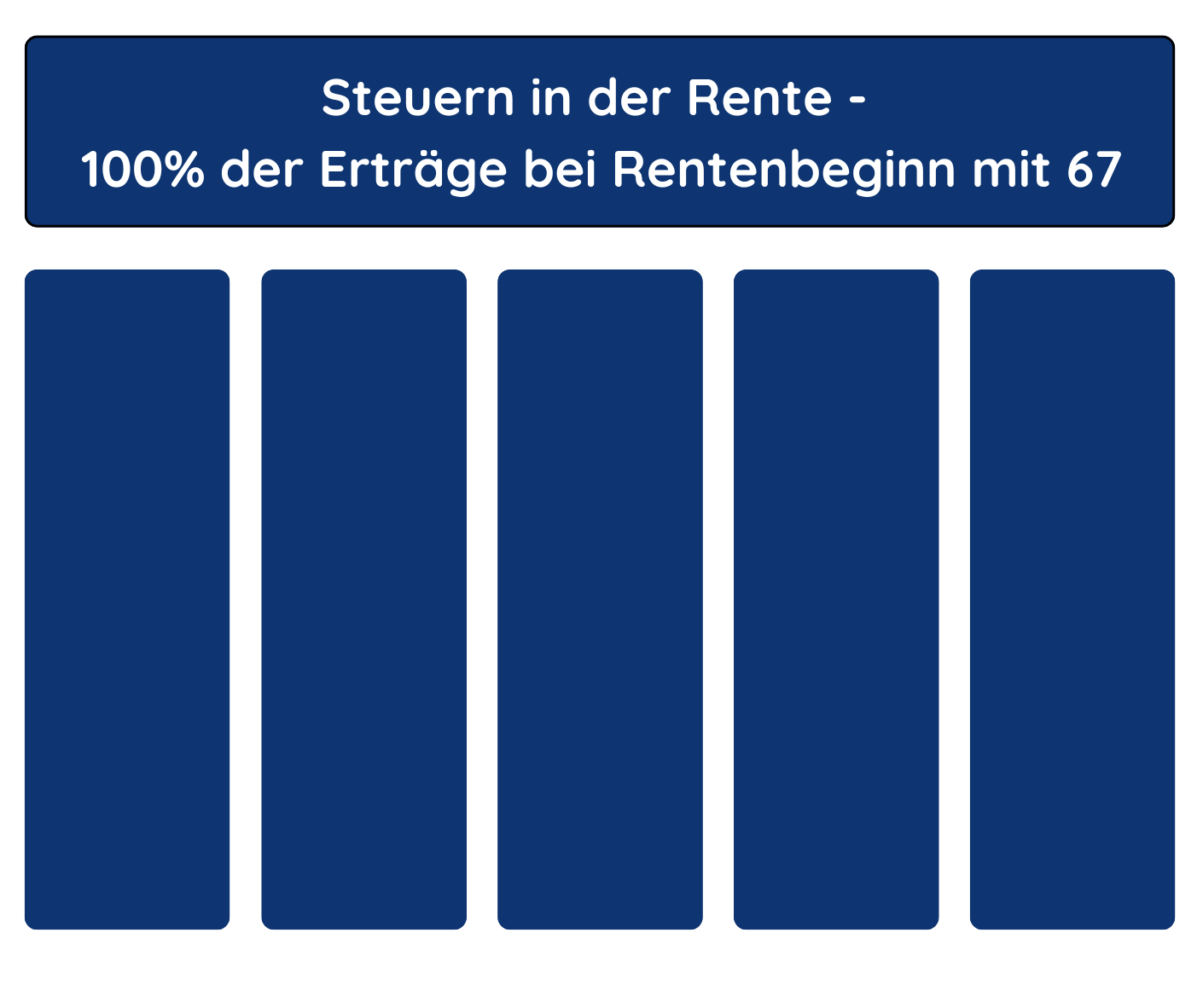
Welche Arten von Riester gibt es?
Für Riester gibt es verschiedene Varianten, über welche die Altersvorsorgeverträge ausgestaltet sein können:
- Riester-Fondssparpläne
- Riester-Rentenversicherungen
- Riester-Bausparverträge
- Riester-Banksparpläne
Was diese einzelnen Riester-Arten auszeichnet und wie sie sich unterscheiden, zeigen wir im Folgenden.
Riester-Fondssparpläne
Der Riester-Fondssparplan kombiniert staatliche Förderung mit den Renditechancen des Kapitalmarkts. Statt in sichere Zinsprodukte fließt das Geld hier in Investmentfonds (auch wahlweise mit Aktienanteil) und bietet dadurch höhere Ertragsmöglichkeiten. Gleichzeitig greift jedoch (wie immer bei Riester) die Beitragsgarantie: Dadurch ist gesetzlich garantiert, dass zum Rentenbeginn mindestens die eingezahlten Beiträge und Zulagen erhalten bleiben. Das mindert jedoch auch die Renditechancen. Ein großer Nachteil ist, dass zu Rentenbeginn ein Vertrag abgeschlossen wird, da ausschließlich Versicherungen die lebenslange Rentenzahlungen gewährleisten dürfen. Die Kosten für einen solchen Vertragsabschluss sind jedoch noch nicht bekannt, eine Black Box also. Unsere geschätzten Kollegen Bierl haben hier diverse Nachteile eines Riester-Fondssparplans beschrieben.
Riester-Rentenversicherungen
Die Riester-Rentenversicherung ist die gängigsten Form der Riester-Vorsorge: Sie kann entweder "klassisch" oder "fondsgebunden" ausgestaltet sein. Sie kombiniert staatliche Förderung mit einer garantierten lebenslangen Rente. Zumindest müssen mindestens 70 % des Vertragsguthabens als lebenslange Rente ausgezahlt werden und maximal 30 % können zum Rentenbeginn als Einmalzahlung ausgeschüttet werden. Das eingezahlte Kapital wird überwiegend in festverzinsliche Anlagen investiert, sodass das Risiko von Kursschwankungen, jedoch auch die Renditechancen gering sind.
Zum Rentenbeginn sind alle Einzahlungen und staatlichen Zulagen garantiert, unabhängig von der Marktentwicklung: Die Beitragsgarantie greift.
Riester-Bausparverträge
Der Riester-Bausparvertrag richtet sich an alle, die mit staatlicher Unterstützung in die eigenen vier Wände investieren möchten. Die geförderten Einzahlungen können für den Kauf, Bau oder die Entschuldung einer selbst genutzten Immobilie verwendet werden.
Wie bei anderen Riester-Formen profitieren Sparer von Zulagen und steuerlichen Vorteilen. Der Riester-Bausparvertrag ist für Menschen geeignet, die Wohneigentum als Teil ihrer Altersvorsorge aufbauen oder ihre Immobilienfinanzierung schneller tilgen möchten.
Das Thema Riester-Bausparverträge/Wohnriester ist sehr komplex. Bei Gelegenheit werden wir dem Thema einen eigenen Artikel widmen.
Riester-Banksparpläne
Riester-Banksparpläne waren lange Zeit eine besonders einfache Form der Riester-Vorsorge. Dabei wurden die Beiträge auf einem verzinsten Sparkonto bei einer Bank angespart. Zum Rentenbeginn waren alle Einzahlungen und staatlichen Zulagen garantiert, Verluste also ausgeschlossen.
Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der geringen Rentabilität bieten Banken heute jedoch kaum noch Riester-Banksparpläne als Neuverträge an. Bestehende Verträge laufen zwar weiter, doch neue Abschlüsse sind in der Regel nicht mehr möglich.
Damit gelten Riester-Banksparpläne heute als Auslaufmodell, das vor allem für Bestandskunden relevant ist, die weiterhin von ihrer sicheren und kostengünstigen Anlageform profitieren.
Welche Form der Altersvorsorge lohnt sich in Deiner persönlichen Situation?
Jetzt kostenlose Beratung sichern!
Berufseinsteigerbonus bei Riester
Für junge Menschen ist bei Riester der sogenannte Berufseinsteigerbonus interessant. Dieser Bonus soll den Einstieg in die private Altersvorsorge erleichtern und richtet sich an alle, die zu Beginn ihres ersten Riester-Vertrags noch keine 25 Jahre alt sind. Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält einmalig eine zusätzliche staatliche Zulage in Höhe von 200 Euro.
Sie wird automatisch zusammen mit der regulären Grundzulage gutgeschrieben, sobald der Vertrag abgeschlossen und der erforderliche Mindesteigenbeitrag geleistet wurde. Der Berufseinsteigerbonus soll junge Erwachsene motivieren, frühzeitig mit der Altersvorsorge zu beginnen.
Kritik an Riester in den letzten Jahren
"Riester ist gescheitert" heißt es in den Medien und das besonders in den letzten Jahren. Ziel war es zunächst, die zu erwartende Rentenlücke durch staatlich gefördertes Sparen zu schließen. Doch während die Grundidee zunächst auf breite Zustimmung traf, hat sich in den letzten Jahren zunehmend gezeigt, dass das Konzept erhebliche Schwächen aufweist. Die Kritik an der Riester-Rente ist in den letztem Jahren so stark wie nie zuvor.
Einer der zentralen Kritikpunkte betrifft die hohen Kosten und die mangelnde Transparenz vieler Riester-Verträge.
Abschluss- und Verwaltungskosten sind oft so hoch, dass ein großer Teil der eingezahlten Beiträge und staatlichen Zulagen in Gebühren fließt. Viele Sparerinnen und Sparer wissen kaum, welche tatsächliche Rendite sie am Ende erwarten können. Da bei Riester ohnehin aufgrund der hohen Beitragsgarantie nicht so hohe Renditen zu erwarten sind, wirken sich die Kosten noch deutlicher aus.
Daher steht auch die Renditeentwicklung selbst massiv in der Kritik!
Die Riester-Rente basiert auf der Garantie, dass zu Rentenbeginn mindestens die eingezahlten Beiträge wieder ausgezahlt werden. Diese Sicherheit hat jedoch zur Folge, dass das angesparte Kapital überwiegend in sehr konservative, also renditeschwache Anlagen investiert werden muss. In Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen führte das dazu, dass viele Riester-Verträge kaum Zuwächse erzielten. Kombiniert mit den hohen Kosten bleibt für viele Anleger unterm Strich nur eine minimale oder sogar negative reale Rendite, vor allem wenn man die Inflation berücksichtigt.
Auch die nachgelagerte Besteuerung der Riester-Rente kann Grund zur Kritik sein.
Die Beiträge werden während der Ansparphase steuerlich begünstigt, doch in der Rentenphase müssen die Auszahlungen voll versteuert werden. Viele Sparerinnen und Sparer unterschätzen diese Belastung, sodass die tatsächliche Nettorente am Ende oft deutlich niedriger ausfällt als erwartet.
Kündigungswelle und Stilllegungen bei Riester
In den letzten Jahren hat sich die Unzufriedenheit mit der Riester-Rente deutlich verschärft. Immer mehr Menschen kündigen ihre Verträge oder lassen sie ruhen, weil sich die Produkte aus ihrer Sicht nicht lohnen. Das Vertrauen in die Riester-Rente ist stark gesunken, was auch an einer wachsenden öffentlichen Kritik und an Berichten über geringe Auszahlungen liegt. Gleichzeitig ist es der Politik bislang nicht gelungen, das System grundlegend zu reformieren. Zwar wurden immer wieder Anpassungen vorgenommen, doch sie blieben meist kosmetischer Natur. Viele Expertinnen und Experten halten die Riester-Rente inzwischen für nicht mehr reformierbar und fordern stattdessen eine neue, einfachere und kostengünstigere Form der privaten Altersvorsorge.
Insgesamt heißt das: Die geringe Entscheidungsfreiheit kombiniert mit den geringen Renditen sorgt dafür, dass sich Riester nur bei starker Bezuschussung durch den Staat lohnt.
Sie lohnt sich eher weniger wenn der Hauptanteil des Geldes von einem selbst kommen muss, was vor allem bei einkommensstarken Menschen der Fall ist.
Ist diese Kritik an Riester berechtigt? Nur mit Abstrichen!
Die generelle Kritik an der Riester-Rente ist in vielen Punkten nachvollziehbar: hohe Verwaltungskosten mancher Verträge, komplizierte Förderregeln, geringe Renditen und eine insgesamt unübersichtliche Struktur haben dazu geführt, dass viele Menschen das Vertrauen in dieses Modell verloren haben. Dennoch gibt es bestimmte Personengruppen, für die die Riester-Rente trotz aller Schwächen ausgesprochen vorteilhaft sein kann.
Besonders gilt das für Menschen mit geringem Einkommen und mehreren Kindern. In diesen Fällen kann Riester sogar zu nahezu 100 % empfehlenswert sein.
Der entscheidende Punkt liegt in der staatlichen Förderung. Bei der Riester-Rente gibt es zwei zentrale Förderarten: die Grundzulage und die Kinderzulage. Jede riesterberechtigte Person erhält eine jährliche Grundzulage, hinzu kommt für jedes kindergeldberechtigte Kind eine zusätzliche Kinderzulage. Gerade für Familien mit mehreren Kindern summiert sich das schnell zu einem beachtlichen Betrag. So können Familien mit zwei, drei oder mehr Kindern jedes Jahr mehrere Hundert bis über tausend Euro an staatlicher Unterstützung erhalten.
Für Menschen mit geringem Verdienst ist das besonders attraktiv, weil der erforderliche Eigenbeitrag zur Erlangung der vollen Förderung verhältnismäßig niedrig ist. Der sogenannte Mindesteigenbeitrag beträgt vier Prozent des sozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens, abzüglich der Zulagen. Das bedeutet: Wer wenig verdient, muss auch nur wenig aus eigener Tasche einzahlen, um die volle staatliche Förderung zu erhalten. In manchen Fällen reicht ein monatlicher Eigenbeitrag von nur wenigen Euro aus, um die kompletten Zulagen zu bekommen.
Nimmt man als Beispiel eine Familie mit drei Kindern und einem Einkommen im unteren Bereich, kann die staatliche Förderung den Großteil der jährlichen Einzahlungen abdecken.
Dadurch entsteht eine außergewöhnlich hohe Förderquote. Das heißt, der Anteil der staatlichen Unterstützung im Verhältnis zur eigenen Einzahlung ist besonders groß. In der Praxis kann das bedeuten, dass das geförderte Kapital schneller wächst, als es durch eigene Beiträge möglich wäre. Selbst wenn die Rendite der Anlage niedriger ist als in Vorsorgen ohne Garantie, überwiegt der Vorteil durch die hohen Zuschüsse.
... einen besseren "Hebel" gibt es für einkommensschwache Personen mit vielen Kindern kaum als über die Riester-Rente.
Fazit zur Riester-Rente
Die Riester-Rente ist kein Alleskönner, aber in den richtigen Fällen ein stark geförderter Baustein für die Altersvorsorge. Ihre größte Stärke liegt in den Zulagen und das insbesondere bei geringem Einkommen und (mehreren) kindergeldberechtigten Kindern. Für diese Zielgruppe kann Riester trotz mäßiger Kapitalmarktrenditen wirtschaftlich außerordentlich attraktiv sein.
Demgegenüber stehen niedrige Renditechancen, Kosten, Komplexität und die starre Auszahlungslogik (meist Rente, nur 30 % Kapital zu Beginn). Für Gutverdienende ohne/mit wenigen Kindern oder für alle, die Flexibilität und reale Rendite in den Vordergrund stellen (z. B. über breit gestreute ETF-Sparpläne), ist Riester häufig nicht die erste Wahl.
Für die genannten Spezialfälle kann Riestern jedoch eine sehr empfehlenswerte Überlegung sein.
Frage daher gerne direkt an, um eine unabhängige Beratung zu sichern und die beste Lösung für deine persönliche Situation zu finden!
Häufige Fragen
Die Riester-Rente ist eine staatlich geförderte, private Altersvorsorge, die seit 2002 existiert. Sie soll helfen, die Rentenlücke im Alter zu schließen. Durch staatliche Zulagen und steuerliche Vorteile unterstützt der Staat alle, die selbst zusätzlich fürs Alter sparen.
Förderberechtigt sind alle Personen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind – also Arbeitnehmer, Auszubildende, Beamte, Richter sowie Eltern in Elternzeit. Auch Ehepartner von Riester-Berechtigten können mittelbar gefördert werden, wenn sie selbst einen Vertrag abschließen. Nicht förderberechtigt sind dagegen Selbstständige und Freiberufler ohne gesetzliche Rentenversicherungspflicht.
Grundzulage: 175 € pro Jahr – Kinderzulage: 300 € pro Jahr für Kinder ab 2008 geboren – 185 € für Kinder, die vor 2008 geboren sind – Berufseinsteigerbonus: einmalig 200 € für Personen unter 25 Jahren beim ersten Vertragsabschluss. Die volle Zulage erhält nur, wer mindestens 4 % seines rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens (abzüglich der Zulagen) in den Vertrag einzahlt.
Riester lohnt sich vor allem für Geringverdiener, Familien mit mehreren Kindern und Alleinerziehende. Durch die Kinderzulagen und den geringen Eigenanteil kann sich die Förderung stark summieren. Oft zahlt der Staat einen deutlich höheren Anteil als der Sparer selbst. Für Gutverdiener ohne Kinder ist Riester dagegen meist weniger rentabel.
Die Beitragsgarantie stellt sicher, dass zu Rentenbeginn mindestens alle Einzahlungen plus Zulagen wieder zur Verfügung stehen – unabhängig von der Marktentwicklung.
Das gibt Sicherheit, begrenzt aber auch die Renditechancen, weil das Kapital vor allem in sichere, zinsarme Anlagen fließt.
Komplexe Förderregeln und hoher Verwaltungsaufwand. Geringe Renditechancen durch Beitragsgarantie. Hohe Kosten bei vielen Versicherungsprodukten. Nachgelagerte Besteuerung in der Rentenphase. Eingeschränkte Flexibilität bei der Auszahlung.
Die Riester-Rente wird im Alter voll versteuert („nachgelagerte Besteuerung“). Das bedeutet: Während der Ansparphase sind Einzahlungen steuerlich begünstigt, in der Auszahlungsphase werden die Renten als Einkommen versteuert. Da das Einkommen im Ruhestand meist niedriger ist, fällt die Steuerlast in der Regel moderater aus.
Riester-Rentenversicherung (klassisch oder fondsgebunden). Riester-Fondssparplan. Riester-Bausparvertrag / Wohn-Riester. Riester-Banksparplan (wird kaum noch angeboten).
Ab dem 62. Lebensjahr kann die Riester-Rente ausgezahlt werden. Bis zu 30 % des Guthabens können einmalig ausgezahlt werden. Der Rest wird als lebenslange monatliche Rente gezahlt. Die Höhe hängt von der Vertragsart, der Laufzeit und der Kapitalentwicklung ab.
Paragraph 84 EStG regelt die Grundzulage (https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__84.html)
Paragraph 85 EStG regelt die Kinderzulage (https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__85.html)
Paragraph § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG regelt den maximal für die Förderung relevanten zu zahlenden Beitrag (https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__10a.html)
Paragraph 86 EStG regelt den Sockelbeitrag (https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__86.html)
Natürlich gibt es diverse weitere Gesetzestexte, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.
Kontaktmöglichkeiten
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang oder bei der Recherche der Versicherungsbedingungen sind dennoch nicht auszuschließen. Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte an kontakt@testberichte-versicherungen.de. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Website kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Finanzberatung Schmitt GmbH übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Treffen Sie niemals eine Kauf- oder Kündigungsentscheidung nur aufgrund eines Testberichts! Bevor Sie solch eine Entscheidung treffen, sollten sie sich von uns oder einem anderen kompetenten und bestenfalls unabhängigen Versicherungsvermittler beraten lassen.




